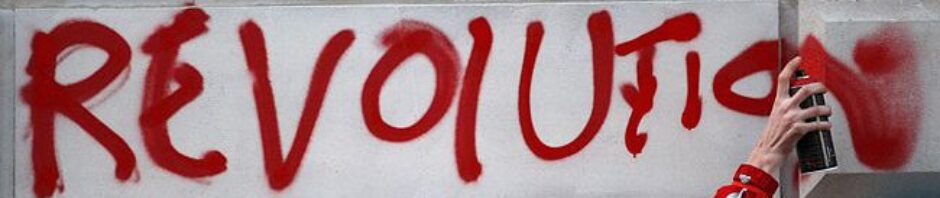https://www.republik.ch/2025/04/01/srf-bi-de-raechtsextreme
Das Reportageformat «rec.» des Schweizer Fernsehens geht mit Rechtsextremen wandern und gibt ihnen Raum für ihre Selbstinszenierung. Für die Junge Tat ist das ein Coup. Für die Schweizer Medienlandschaft ein Dammbruch.
«Hä? Das ist doch ein 1A Werbespot. Wtf», schreibt ein deutscher Rechtsextremist auf X.
«👌🏻 Richtig gut. Abgesehen von den üblichen Diffamierungen», antwortet Manuel Corchia, der Chef der rechtsextremen Gruppierung Junge Tat – und meint mit dem Emoji nicht etwa «okay», sondern «white power».
«Endlich wird mit meinen Zwangsgebühren Sinnvolles produziert, 1A-Werbung. ✊🏻», schreibt auch der Corona-Massnahmengegner Nicolas Rimoldi, der mit den Rechtsextremen zusammenarbeitet und regelmässig an ihren Veranstaltungen teilnimmt.
Die «Werbung», über die sich die Rechtsextremisten so freuen, sollte eigentlich keine Werbung sein, sondern eine Reportage von SRF. Doch herausgekommen ist nicht weniger als einer der grössten Coups, die die Junge Tat in ihrer viereinhalbjährigen Geschichte bisher landen konnte: ihre Inhalte, ihre Forderungen, ihre Bildsprache – verbreitet vom grössten Verstärker, den es in der Schweiz für audiovisuelle Inhalte gibt.
72’000 Views verzeichnete der «Werbespot» keine 30 Stunden nach seiner Veröffentlichung auf Youtube. Noch nie in ihrer Geschichte bekam die Junge Tat derart viel Platz in einem Schweizer Medium, um ihre Inhalte direkt beim Publikum zu platzieren.
Die Junge Tat ist eine rechtsextreme Organisation, die aus der organisierten Schweizer Neonaziszene entstanden ist. Heute ist sie der neuen Rechtsextremen nach dem Vorbild der Identitären Bewegung zuzurechnen. Die Mitglieder der Jungen Tat gehen sehr strategisch vor, pflegen gute Beziehungen zu internationalen Rechtsextremen und hängen immer noch mit Hitler-Fans rum.
Entstanden ist die Reportage über diese Rechtsextremisten für das SRF-Format «rec.». «‹rec.› steht für ‹record›», schrieb die Medienstelle des SRF, als die Sendung vor vier Jahren eingeführt wurde. «Das rund 20-minütige Reportageformat ‹rec.› taucht jede Woche in Szenen, Mikrokosmen und Lebenswelten ein, die das Publikum und die Reportagebegeisterten bewegen.»
In dieser Woche bestand die «Szene», der «Mikrokosmos», die «Lebenswelt» aus Nazisymbolen, rechtsextremen Tarnbegriffen und verharmlosender Selbstinszenierung.
Und «SRF rec.» tauchte bis zum Hals ein.
«Embedded Journalism» an der Wanderfront
Die Reportage beginnt – nach einem kurzen Intro – in üblicher «rec.»-Manier. Das heisst: mit dem Reporter Samuel Konrad, der sich selbst filmt, wie er zu einem Treffen mit den Rechtsextremisten fährt. Die haben ihn nämlich zu einer ihrer Wanderungen eingeladen, mit denen sie mehrmals jährlich neue Leute rekrutieren.
Während der Wanderung merkt man schnell, wie sehr sich das Fernsehen von den Rechtsextremen die Bedingungen vorgeben lässt. Der Reporter wird ständig überwacht: Die Chefs der Jungen Tat schauen, wo er ist und mit wem er worüber spricht. Als er ein einziges Mal mit einem verpixelten und pseudonymisierten Teilnehmer sprechen darf und diesen fragt, ob ein Verbot der Jungen Tat für ihn eine rote Linie wäre, antwortet statt des Interviewten die Aufpasserin: «Nein nein nein, lieber Severin. Dann erst recht!»
Was die Antwort des Neumitglieds «Severin» wäre, erfährt man in der Reportage nicht. Und auch nicht, was andere Teilnehmerinnen zu sagen hätten. Denn – so beschreibt es der Reporter zu Beginn der Wanderung – «SRF rec.» hat mit der Jungen Tat «abgemacht», mit wem man «überhaupt reden darf».
Darum kommen immer wieder nur die offiziellen – und ziemlich sicher vorbereiteten – Exponenten der Jungen Tat zu Wort und können ihre Inhalte an das Fernsehpublikum verbreiten. Das Leben als Mitglied der Jungen Tat sei «saugeil», sagen diese, man könne gratis an Boxtrainings teilnehmen und man sei ja gar nicht gegen queere Menschen, sondern wolle nur verhindern, dass Kindern «das» aufgezwungen werde.
In einem Fall zeigt das SRF in seiner Reportage sogar eine Sequenz, in der ein Junge-Tat-Anführer ein Buch von Martin Sellner in die Kamera hält. Sellner ist der Kopf der österreichischen Identitären Bewegung und aktuell der wohl einflussreichste Rechtsextremist im deutschsprachigen Raum.
Auf die Frage, warum SRF diese weitreichenden Einschränkungen seiner Arbeit akzeptiert hat, antwortet die Sendungsverantwortliche Anita Richner sehr allgemein. «SRF rec.» zeige «unterschiedliche Lebenswelten und Werthaltungen» auf und wolle «kontroverse Themen» besprechen. Die Bedingungen, unter denen der Reporter arbeiten «musste», habe man transparent gemacht. Und man habe den Anspruch, «echte und authentische Einblicke zu gewähren».
Wie «echt und authentisch» diese Einblicke noch sind, wenn die Junge Tat derart starke Vorgaben macht, geht aus der Stellungnahme nicht hervor. Auch dass man derartige Bedingungen als Journalist selbstverständlich einfach ablehnen kann, spielt offenbar keine Rolle.
Die Strategie der neuen Rechtsextremen
Zwar versucht die Reportage mehrmals, die Junge Tat kritisch einzuordnen. So befragt der Journalist die zwei Anführer zu ihrem Logo – einer Rune, die von der NSDAP verwendet wurde – oder konfrontiert sie mit, wie er es nennt, «dem Rassismus-Vorwurf». Die Rechtsextremisten reagieren mit eingeübten Antworten: Man lasse sich das Symbol in ihrem Logo nicht wegnehmen, «bloss weil es in einer Zeitspanne von 12 Jahren mal falsch verwendet wurde». Und man werte «andere Völker» nicht ab, sondern bejahe «unser Volk und unsere Kultur».
Viel wert sind solche Antworten nicht. Es gehört zur Strategie neuer Rechtsextremer wie der Jungen Tat, dass sie sich nicht offen zum Nationalsozialismus bekennen und ihre Positionen so formulieren, dass man ihnen keinen Strick daraus drehen kann. Sie wollen provokant genug sein, um die Grenzen des Sagbaren zu verschieben, aber auch anschlussfähig genug, um die Normalisierung ihrer Begriffe und Forderungen zu erreichen. So hat es Martin Sellner, der Kopf des österreichischen Rechtsextremismus, einmal formuliert.
Ein Geheimnis ist diese Strategie nicht: Man kann sie in den Büchern nachlesen, die die Junge Tat in ihrem Onlineshop verkaufen will. Die Journalisten von «SRF rec.» durchschauen dieses Vorgehen der neuen Rechtsextremen offensichtlich nicht. Stattdessen laufen sie geradewegs in deren Falle.
Dabei geben die publizistischen Leitlinien von SRF eigentlich etwas anderes vor: «Um Aufmerksamkeit zu schaffen, lancieren Akteurinnen und Akteure sowie Interessen- und Lobbygruppen ihre Themen zunehmend nach Marketingkriterien und aufgrund von Überlegungen des Ereignismanagements. Auf die Aufbereitung beziehungsweise die Inszenierung eines Themas legen sie dabei ebenso viel Wert wie auf den Inhalt. Wir müssen diese Methoden kennen und dürfen uns nicht instrumentalisieren lassen.»
Eine ernsthafte Einordnung dessen, was die Junge Tat jenseits ihrer Selbstvermarktung ist, bieten nur ein paar Zwischensequenzen in der Reportage. Etwa wenn der SRF-Extremismusredaktor Daniel Glaus die Geschichte der Gruppierung und ihre Begriffe einordnet. Oder wenn der Journalist Samuel Konrad nach den Aussagen der Junge-Tat-Anführer jeweils seine Meinung zum Gesagten äussert. Oder – ein bisschen – wenn Strafrechtsprofessor Martino Mona darauf hinweist, dass die Junge Tat abweichende Lebensformen ausmerzen will. Aber eben nur ein bisschen, denn Mona fügt hinzu, dass sich das «abstrakt» zwar nicht mit einer freiheitlichen Gesellschaft vertrage, gerade eine freiheitliche Gesellschaft müsse solche Tendenzen in der Bevölkerung aber «respektieren» und «zulassen».
Mit diesen Einschüben rechtfertigt «SRF rec.» seine Reportage auch in den Kommentaren zum Youtube-Video und in seiner Stellungnahme gegenüber der Republik. Doch wenn die Einordnung von Rechtsextremen sich abwechselt mit der Propaganda der Rechtsextremen, dann verkommt der ganze Beitrag zu einer Both-sides-Übung: hier die Rechtsextremen, die behaupten, gar nicht rechtsextrem zu sein. Dort die Fachpersonen, die betonen, dass die Rechtsextremen rechtsextrem sind.
Und die Wahrheit – so der Eindruck, den die Reportage hinterlässt – muss wohl irgendwo dazwischenliegen.
Fast die Kurve gekriegt – aber nur fast
Dabei hinterfragt der SRF-Reporter seine Rolle durchaus. Zwischen all der rechtsextremen Selbstinszenierung und den kritischen Beurteilungen sticht eine Sequenz heraus, in der Konrad selber auf den Punkt bringt, was eigentlich das Problem ist an dieser Reportage, die er da gerade produziert.
Der Journalist sitzt in seinem Auto und denkt laut in die Kamera. Zuvor hat er eine PR-Aktion der Jungen Tat mit Martin Sellner gefilmt. Dort hat ihn eine Gegendemonstrantin angesprochen und ihm gesagt, er stehe auf der falschen Seite.
Er frage sich das schon, ob er auf der falschen Seite stehe, sagt der Reporter. «Solche Aktionen wie heute haben einen Zweck, nämlich Aufmerksamkeit zu generieren. Für Gruppen wie die Junge Tat, Personen wie Martin Sellner und so indirekt für die Inhalte, die sie vertreten. Damit ihre Positionen Anschluss finden in der Mitte der Gesellschaft. Damit verschoben werden kann, was man sagen darf und was nicht.»
Auch die Reportage, die er gerade am Produzieren sei, generiere solche Aufmerksamkeit. Und darum habe die Gegendemonstrantin vielleicht nicht unrecht, vielleicht stehe er auf der falschen Seite.
An diesem Punkt – so denkt man – hätte «SRF rec.» die Übung eigentlich abbrechen müssen. Offenbar war dem Reporter bewusst, wie er den Rechtsextremisten gerade zudient. Doch dann greift er auf das Standardargument zurück, mit dem Journalistinnen fast jede Geschichte rechtfertigen können, die sie gerne machen möchten – oder in die sie schon so viel investiert haben, dass sie sie nicht mehr abbrechen wollen.
«Ich glaube, dass es genauso wichtig ist, zu erzählen, was die Strategie dieser Gruppen ist.» Wie sie vorgingen, wie sie versuchten, Anschluss zu finden und ihre Ideologien salonfähig zu machen. «Stehe ich auf der falschen Seite? Ich hoffe schlussendlich, auf keiner Seite zu stehen, sondern einfach zu zeigen, was ist.»
Zeigen, was ist. Ausser eben das, was die Junge Tat nicht gezeigt haben möchte.
Dammbruch
Selbstverständlich hat der SRF-Journalist recht, wenn er sagt, dass man die Strategien der neuen Rechtsextremen aufzeigen und erklären muss. Das tun seit vielen Jahren auch viele Journalistinnen in der Schweiz. Doch dabei die Rechtsextremen in aller Ausführlichkeit zu Wort kommen zu lassen, ihnen Gelegenheit zu geben, sich zu verharmlosen und zu inszenieren – das braucht es dafür nicht.
Dieser Meinung sind auch rund 200 Medien- und Kulturschaffende, die kurz nach Ausstrahlung des Beitrags einen Brief unterzeichnet haben. Darin kritisieren sie unter anderem, dass der Jungen Tat eine breite Plattform geboten und das Thema als unterhaltsame Provokation verkauft worden sei. Der Brief wurde vergangene Woche der Redaktion von «SRF rec.», der Ombudsstelle der SRG und dem Publikumsservice des SRF zugestellt.
Es scheint, als habe «SRF rec.» nicht erkannt, dass die neue Rechtsextreme ein fundamental anderes Verhältnis zu Medien hat als ihre klassisch neonazistischen Kameraden. Die Glatzennazis von früher scheuten die Öffentlichkeit. Sie trafen sich im Geheimen zu Rechtsrockkonzerten, um dort unter sich und ungestört abhitlern zu können. Wenn Medien sie an die Öffentlichkeit zerrten, waren sie weder erfreut noch vorbereitet.
Die neuen Rechtsextremen aber sehen die Medien als Instrument. Sie sind PR-Agenturen, die sehr gut wissen, wie man sich einem breiten Publikum gegenüber darzustellen hat. Sie geben sich brav und nahbar. Sie verpacken ihre Menschenverachtung in beschönigende Worte. Und sie distanzieren sich von «Jugendsünden».
Egal, wie viel Einordnung drumherum passiert – Medien, die diese Inszenierungen zulassen, fallen auf eine Strategie herein.
Denn die braven Rechtsextremen trainieren den Strassenkampf. Ihre schönen Worte bedeuten Segregation und Vertreibung. Für ihre «Jugendsünden» – wie es die Junge Tat selber nennt – wurden sie verurteilt, als Junge-Tat-Chef Manuel Corchia schon zwanzig Jahre alt war. Und diese «Sünden» bestanden darin, an Adolf Hitlers Geburtstag in einem Zoom-Call «Heil Hitler» zu schreien und Aufkleber mit Begriffen wie «Rassenmischen» oder «Mischkinder» zu drucken.
Bisher bestand in der Schweizer Medienlandschaft – bis auf wenige Ausnahmen – das stillschweigende Einverständnis, dass man die Junge Tat nicht wie eine gewöhnliche Organisation behandelt. Dass man sie nur zu Wort kommen lässt, wenn es zwingend notwendig ist – etwa wenn man sie mit schwerwiegenden Vorwürfen konfrontieren muss. Und dass man anhand ihrer Inhalte zwar aufzeigt, wie sie funktionieren – ihnen aber nicht den Raum gibt, extra für die Medien vorbereitete Statements abzugeben.
«SRF rec.» hat dieses Einverständnis nun gebrochen. Ohne Not geben die Journalistinnen der Jungen Tat grosszügige Redezeit. Und tragen so zur Normalisierung einer rechtsextremen Gruppierung bei, deren explizites Ziel die eigene Normalisierung ist.
Um zu begreifen, in wessen Interesse die Reportage am Ende war, genügt es eigentlich, den Rechtsextremisten selbst zuzuhören.
«Dieses Mal haben wir die Doku als klar vorteilhaft eingestuft – da m.A.n das SRF-Jugendformat unglaublich Reichweite für uns schafft.»
Das sagte letzte Woche der Anführer der Jungen Tat.
Und postete einen Link auf die Sendung.